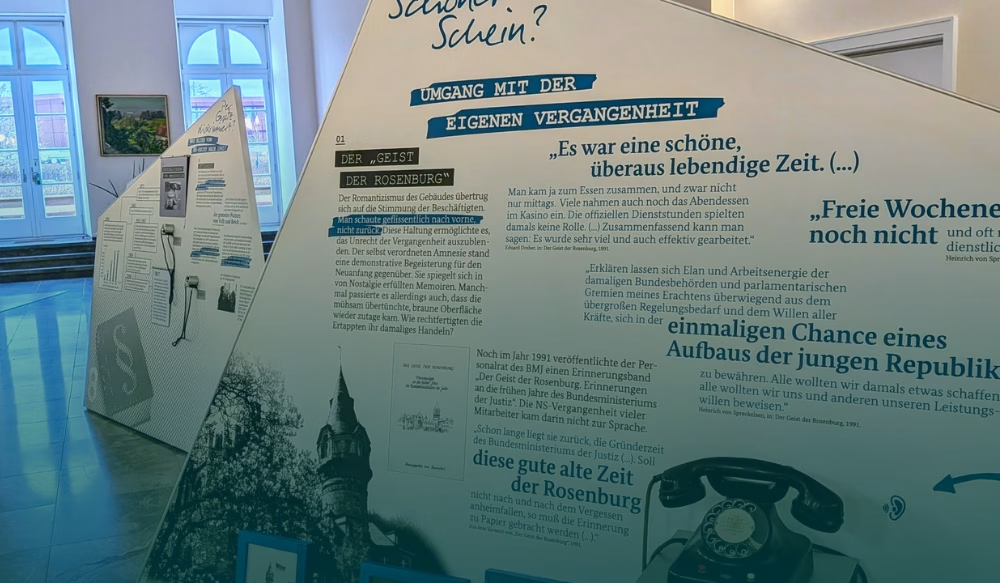„Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen dürfen.“ – Dieser berühmte, dem Philosophen Voltaire zugeschriebene Satz gilt bis heute als die wohl prägnanteste Formulierung der freiheitlichen Meinungsäußerung. Doch was passiert, wenn Worte nicht mehr Ausdruck freier Debatte sind, sondern zu Waffen werden? Wenn digitale Räume zu Brandherden des Hasses werden – gegen Politikerinnen und Politiker, gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Jüdinnen und Juden?
Hass in den sozialen Medien hat viele Gesichter: mal brüllend laut, mal perfide codiert; mal als plumpe Beleidigung, mal als Deepfake mit zerstörerischer Wucht. Spätestens seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag des beispiellosen Terrorangriffs der Hamas auf Israel, ist auch der Antisemitismus in den digitalen Netzwerken mit neuer Schärfe und erschreckender Selbstverständlichkeit zurückgekehrt – oft unter dem Deckmantel „politischer Kritik“, doch in Wahrheit getragen von blankem Hass.
Wie also soll, darf, muss ein demokratischer Rechtsstaat auf diesen Sturm reagieren? Wo verläuft die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und strafbarer Hetze? Und wie gelingt es, die Freiheitsrechte zu bewahren, ohne die Schutzpflicht des Staates zu vernachlässigen – gerade dann, wenn es um besonders verletzliche Gruppen oder Fragen von historischer Verantwortung geht?
Fragen wie diese standen im Zentrum einer hochkarätig besetzten Tagung an der Universität Würzburg. Unter dem Titel „Hass in sozialen Medien aus Sicht von Wissenschaft und Praxis“ kamen Expertinnen und Experten aus Justiz, Zivilgesellschaft und Rechtswissenschaft zusammen, um gemeinsam nach Antworten zu suchen – in einem Spannungsfeld, das aktueller kaum sein könnte.
Ein Projekt zwischen Digitalität und Dogmatik
Nach einleitenden Worten von Prof. Dr. Frank Schuster skizzierte Prof. Dr. Tobias Reinbacher den Rahmen des Projekts. Der Strafrechtswissenschaftler sprach offen – auch persönlich. So berichtete er, dass er sich kürzlich von „X“ (vormals Twitter) zurückgezogen habe und diesen Schritt durchaus als wohltuend empfunden habe.
Das von der Deutschen Forschungsgesellschaft unterstützte Projekt „Soziale Medien und Strafrecht“, das von der Würzburger Juristischen Fakultät getragen wird und den Rahmen für die Tagung bot, will diesen Fragen nachgehen. Im Mittelpunkt stehen strafrechtliche Herausforderungen im digitalen Raum – von Beleidigung bis Hetze, von Social Bots bis hin zu Deepfakes. Die Forschung sucht nicht nur nach juristischen Lösungen, sondern auch nach philosophischer Orientierung: Wie lässt sich der Schutz der Meinungsfreiheit mit der Notwendigkeit vereinbaren, Persönlichkeitsrechte effektiv zu wahren?
Meinungsfreiheit – ein Grundrecht unter Spannung
Dass die Meinungsfreiheit ein demokratisches Grundrecht ersten Ranges ist, daran ließ Prof. Reinbacher keinen Zweifel. Doch ebenso klar wurde: Sie ist kein Freibrief. Sie endet dort, wo die Würde des Menschen verletzt, wo der Boden der sachlichen Auseinandersetzung verlassen und in Formalbeleidigungen oder Schmähkritik abgedriftet wird.
Diese Grenzziehung hat eine lange Geschichte im deutschen Verfassungsrecht. Unvergessen bleibt das berühmte Lüth-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1958, das der Meinungsfreiheit eine „konstituierende Bedeutung“ für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zusprach. Und doch hat sich die juristische Landschaft seither weiterentwickelt: Spätestens mit den Entscheidungen im Fall Renate Künast – die sich juristisch gegen frauenfeindliche Hetze zur Wehr setzte – begann das Bundesverfassungsgericht, die Abwägung neu zu justieren: weg von einem fast schrankenlosen Freiheitsverständnis, hin zu einem stärkeren Schutz der Persönlichkeitsrechte.
Die Tagung knüpfte hier an – mit dem Ziel, ein neues, digitales Gleichgewicht zu finden.
Was ist Hate Speech – und was macht sie mit uns?
Im Zentrum der Würzburger Tagung stand der vielschichtige Begriff der Hassrede – oder, international gebräuchlicher, Hate Speech. Die Arbeitsdefinition, angelehnt an das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, bringt die Problematik klar auf den Punkt: Hate Speech meint Posts und Kommentare im Internet, die abwerten, aufhetzen, beleidigen und/oder bedrohen – oftmals rassistisch, sexistisch, antisemitisch, homophob oder transphob motiviert. In der digital vernetzten Öffentlichkeit unserer Zeit verbreiten sich derartige Inhalte mit rasanter Geschwindigkeit – und stellen damit eine konkrete Gefahr für den demokratischen Diskurs dar.
Die strafrechtliche Antwort auf diesen Hass im Netz ist ebenso vielgestaltig wie der Hass selbst. Eine Vielzahl klassischer Tatbestände – von der Beleidigung über die Bedrohung bis zur Verleumdung – greift auch im digitalen Raum. Doch zunehmend in den Mittelpunkt der juristischen und politischen Debatte gerückt ist in den letzten Jahren § 188 StGB. Die Vorschrift schützt Repräsentantinnen und Repräsentanten des öffentlichen Lebens – insbesondere politische Amtsträger – vor ehrverletzenden Angriffen, sofern diese geeignet sind, deren öffentliche Tätigkeit erheblich zu beeinträchtigen. Seit der Reform im Jahr 2021 sieht der Gesetzgeber für solche Fälle eine deutlich verschärfte Strafandrohung vor.
Diese Gesetzesverschärfung war eine Reaktion auf eine neue Qualität digitaler Gewalt: Bürgermeisterinnen, Abgeordnete und Kommunalpolitiker geraten immer häufiger ins Visier gezielter, oft kampagnenartiger Hassangriffe. Die Botschaft des Gesetzgebers ist klar: Wer mit Hass auf Amtsträger zielt, trifft die Demokratie selbst – und wird deshalb schärfer bestraft.
Doch gerade diese Strafschärfung ruft Kritik hervor. Juristinnen und Juristen warnen vor einer Sonderstellung politischer Akteure im Strafrecht, die im Spannungsverhältnis zur Meinungsfreiheit stehen könnte. Kritisiert wird auch die Unschärfe der gesetzlichen Formulierung: Wann eine Äußerung „geeignet“ ist, die öffentliche Tätigkeit zu erschweren, lässt sich in der Praxis nur schwer greifen und birgt die Gefahr einer Ausweitung staatlicher Eingriffsbefugnisse. So steht § 188 StGB exemplarisch für ein strafrechtliches Dilemma: den legitimen Schutz vor digitalem Hass einerseits – und die notwendige Bewahrung freiheitlicher Kommunikationsräume andererseits.
Was einst auf Schulhöfen geflüstert wurde, kann heute binnen Sekunden millionenfach verbreitet werden – mit gravierenden Folgen für Betroffene und für die Zivilgesellschaft als Ganzes.
Wenn die Worte schneiden: Katharina Goede über digitale Gewalt
Wie sich dieser Hass konkret anfühlt, zeigte Katharina Goede von der zivilgesellschaftlichen Organisation HateAid. Die Juristin kämpft an vorderster Front gegen digitale Gewalt – und schilderte eindrucksvoll, wie vielfältig und zerstörerisch sie sich äußert:
Beleidigungen. Bedrohungen. Cyberstalking. Und zunehmend: Deepfakes – täuschend echte, computergenerierte Videos oder Bilder, die Menschen in kompromittierenden Situationen zeigen, die sie nie erlebt haben.
Deepfakes seien, so Goede, keine Randerscheinung mehr, sondern eine aufziehende Sturmfront. Besonders perfide sei dabei: „Nicht einmal die Erstellung solcher Inhalte ist bislang strafbar – nur deren Verbreitung.“ Ein unhaltbarer Zustand, der Opfer schutzlos zurücklässt.
Viele Betroffene, so Goede, sind Frauen. Sie wenden sich verzweifelt an HateAid, nachdem intime Bilder verfälscht, Identitäten missbraucht und Existenzen vernichtet wurden. Nicht selten steht das Leben der Betroffenen danach „komplett Kopf“.
Die Organisation, die auf Spenden und staatliche Förderung angewiesen ist, gerät angesichts der hohen Nachfrage an ihre Grenzen. Mehrfach musste HateAid Beratungsstopps einführen – zu groß war der Ansturm, zu gering die Ressourcen.
Deepfakes: Die neue Waffe gegen die Wirklichkeit
Doch was genau sind Deepfakes? Die Bezeichnung steht für künstlich erzeugte, realistisch wirkende Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen, die mithilfe von KI-Algorithmen manipuliert werden. Was früher Hollywood-Studios vorbehalten war, ist heute via App in wenigen Minuten erstellt – und wird zunehmend zur Waffe gegen Unschuldige.
Laut Studien enthalten über 90 % aller Deepfakes pornografisches Material – fast ausschließlich mit weiblichen Opfern. Ein Angriff auf die Intimität, der tiefer geht als jede Beleidigung. Und ein juristisches Niemandsland, das dringend reguliert werden muss.
Wenn Worte Waffen werden – und Strafe die letzte Antwort ist
Mit juristischem Blick und unmissverständlicher Klarheit trat David Beck, Hate-Speech-Beauftragter der Bayerischen Justiz, ans Rednerpult. Er ist einer der profiliertesten Köpfe im Kampf gegen digitale Hetze – und machte eindrücklich deutlich: „Hass und Hetze im Netz sind nicht nur gefährlich – sie können auch teuer werden.“
Anhand realer Fälle zeigte Beck, wie aus kurzen, wütenden Sätzen empfindliche Geldstrafen werden:
- „Bürgermeister, jede Nacht könnte jemand kommen“ – 1.200 Euro Geldstrafe durch das Amtsgericht Schweinfurt
- „Erschießen diesen Idioten“ – 3.600 Euro, verhängt vom Amtsgericht Miesbach
- „Den Deppen sofort an die Wand stellen“ – 4.500 Euro, geurteilt in Traunstein
Beck illustrierte nicht nur, wie strafbar Hass im Netz ist, sondern auch, wie entschieden die Justiz in Bayern inzwischen vorgeht. Seit Jahren verfolgt das bayerische Justizministerium eine Null-Toleranz-Strategie: Eine eigene Meldestelle für Hate Speech, spezialisierte Staatsanwälte in jedem Landgerichtsbezirk und regelmäßige Aktionstage gegen Hass im Netz – zuletzt am 25. Juni 2025 – zeigen: Der Rechtsstaat hat begonnen, das digitale Terrain zurückzuerobern.
Am bundesweiten Aktionstag wurden in allen 16 Bundesländern über 100 Durchsuchungen und Vernehmungen durchgeführt – ein deutliches Signal: Auch virtuelle Gewalt hat reale Konsequenzen.
Dass die Fallzahlen bei bayerischen Staatsanwaltschaften steigen, wertet Beck nicht nur als Zeichen zunehmender Aggression, sondern auch als Erfolg bei der Aufklärung des Dunkelfelds: Viele Opfer schweigen nicht mehr – und viele Täter werden sichtbar.
Die digitale Frontlinie: Wenn Justiz auf Internet trifft
Wie entschlossen der Rechtsstaat gegen Hass im Netz vorgeht, zeigte Hanno Wilk von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt – mit einem Einblick in eine Spezialeinheit, die dort ansetzt, wo digitale Enthemmung in strafbares Verhalten umschlägt. Die ZIT, 2010 gegründet, ist mittlerweile eine der schlagkräftigsten Institutionen der Republik im digitalen Raum.
Ein besonderer Fokus der ZIT lag früh auf der strafrechtlichen Verfolgung von Hasskommentaren und öffentlichen Bekundungen der Zustimmung zur Tat nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019. Die digitale Hetze, die diesem politisch motivierten Attentat folgte, wurde von der ZIT als eines der ersten zentralen Arbeitsfelder erkannt – und zum Gegenstand intensiver Ermittlungsarbeit gemacht.
Wilk erinnerte eindringlich: „Dieser Mord kam nicht aus dem Nichts.“ Schon lange vor dem tödlichen Schuss war Lübcke im Netz Zielsystem für Hass, Hetze und Gewaltfantasien. Die ZIT übernahm die Koordination der Verfolgung von Hass-Postings im Zusammenhang mit dem Attentat – und ging entschlossen vor: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, und staatliche Stellen müssen sich dort bewegen, auch wenn, wie Wilk formulierte „Streifenwagen normalerweise noch nicht durch soziale Medien fahren“.
Der lange Atem des Rechts – Chan-jo Jun über den juristischen Kampf gegen digitale Gewalt
Den Schlussakkord setzte der Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun, einer der profiliertesten digitalen Kämpfer gegen Hass im Netz. Jun hat sich als Opferanwalt einen Namen gemacht – und als unbeirrter Kläger gegen große soziale Netzwerke.
In seinem Vortrag, den er gemeinsam mit seiner Kanzleikollegin Jaqueline Sittig hielt, schilderte Jun Fälle, die bundesweit Schlagzeilen machten: die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Fall Renate Künast, bei der Jun maßgeblich beteiligt war, oder auch die juristische Auseinandersetzung mit Meta (ehemals Facebook) zur Löschung rechtswidriger Inhalte.
Doch seine Arbeit bleibt nicht ohne persönliche Konsequenzen: „Ich habe mehr als einmal Morddrohungen erhalten. Einmal war es so konkret, dass ich mit meiner Familie die Stadt verlassen musste.“ Der Hass, den Jun bekämpft, zielt nicht nur auf Mandanten – sondern auf ihn selbst.
Er betonte, wie aufreibend, teuer und langwierig der juristische Kampf gegen große Plattformen sei: „Ohne einen langen Atem, juristische Expertise und ausreichende finanzielle Mittel ist dieser Weg kaum zu gehen.“ Dennoch – oder gerade deshalb – sei der Gang vor Gericht ein zentraler Bestandteil demokratischer Gegenwehr.
Zwischen Strafrecht und Debattenkultur – der schwierige Kampf um die Grenzen
Die Tagung endete mit einem klaren Eindruck: Hass im Netz ist längst keine Randerscheinung mehr. Er ist Ausdruck gesellschaftlicher Verrohung, politischer Radikalisierung – und einer Plattformlogik, die Wut oft stärker belohnt als Argumente.
Doch je sichtbarer der Staat bei der Bekämpfung von Hate Speech auftritt, desto deutlicher wird auch die Gegenbewegung. In den vergangenen Monaten rückten immer wieder Fälle in den medialen Fokus, in denen Bürgerinnen und Bürger wegen Äußerungen im Internet polizeilich verfolgt wurden – darunter auch solche, die am Stammtisch milder erscheinen mögen als im Strafgesetzbuch. Viele Medien stellten daraufhin in zahlreichen Artikeln infrage, ob es verhältnismäßig sei, Menschen wegen polemischer Online-Kommentare mit Hausdurchsuchungen zu konfrontieren. Dabei wird oft die Sorge geäußert, die Justiz schieße über das Ziel hinaus und gefährde die Meinungsfreiheit selbst.
Wie weit darf der Rechtsstaat gehen, um diese Entwicklung zu stoppen? Ist das Strafrecht das richtige Mittel, um politische Diskurse im Netz zu zivilisieren? Um emotionale Debatten, schrille Polemik oder dumme Wut in den Griff zu bekommen?
Die Antwort bleibt unbequem: Nein, das Strafrecht kann und darf keine Meinung verbieten – aber ja, es muss dort einschreiten, wo die Grenze zur strafbaren Hetze überschritten wird. Wo Menschen bedroht, diffamiert, zum Schweigen gebracht oder zur Gewalt aufgerufen werden. Der Rechtsstaat darf in diesen Fällen nicht neutral bleiben.
Die Referenten in Würzburg machten deutlich: Der Grat zwischen dem Schutz der freien Rede und dem Schutz vor digitalem Hass ist schmal. Doch in Zeiten, in denen das Netz zur Waffe wird, ist juristisches Handeln nicht Zensur, sondern Zivilisationspflicht.
Was darüber hinaus gebraucht wird, sind gesellschaftliche Antworten: Bildung, Medienkompetenz, Plattformregulierung – und eine neue Ethik der digitalen Öffentlichkeit. Nur wenn Strafverfolgung flankiert wird von Aufklärung, Dialog und einem klaren zivilgesellschaftlichen Wertefundament, wird der Rechtsstaat im Netz Bestand haben.
Denn eines ist sicher: Der Hass macht keine Pause. Und er braucht eine entschlossene Antwort. Aber auch eine kluge.