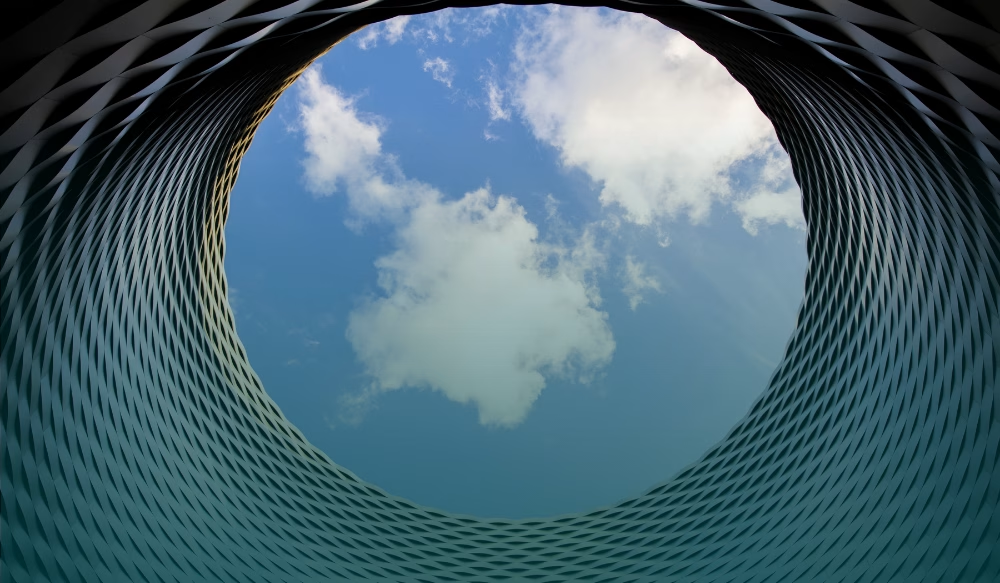Berlin, 10. November 2025 (JPD) – Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung des Wehrdienstes stößt in der Fachanhörung des Verteidigungsausschusses auf deutliche Kritik. Mehrere Sachverständige äußerten Zweifel daran, dass die geplanten Maßnahmen ausreichen, um den Personalbedarf der Bundeswehr zu decken und die sicherheitspolitischen Verpflichtungen Deutschlands gegenüber der NATO zu erfüllen.
Experten sehen Wehrdienst-Modernisierung skeptisch
Der Historiker Sönke Neitzel (Universität Potsdam) und der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, Oberst André Wüstner, bezeichneten die Zielzahlen von 260.000 aktiven Soldaten und 200.000 Reservisten als nicht belastbar. Das Verteidigungsministerium habe bislang keine nachvollziehbare Grundlage für diese Berechnungen vorgelegt, kritisierte Neitzel. Auch Wüstner sprach von einer bloßen „groben Schätzung“ ohne politisch abgestimmtes Fähigkeitsprofil. Der tatsächliche Bedarf liege seiner Einschätzung nach über 300.000 Soldaten.
Generalleutnant Robert Karl Sieger, Leiter des Bundesamts für das Personalmanagement der Bundeswehr, verwies darauf, dass ein konkreter Plan zum Truppenaufwuchs bis Frühjahr 2026 vorgelegt werden solle. Neitzel nannte das angesichts der bekannten NATO-Anforderungen „absurd“.
Zweifel an Freiwilligkeit und Forderung nach Rückkehr zur Wehrpflicht
Mehrere Experten äußerten die Befürchtung, dass die Personalziele ohne Wiedereinführung einer Wehrpflicht nicht zu erreichen seien. General a.D. Joachim Wundrak sprach von einem „strategischen Fehler“, die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt zu haben. Maßnahmen wie höhere Soldzahlungen oder Zuschüsse zum Führerschein würden nicht ausreichen, um genügend Freiwillige zu gewinnen. Wundrak plädierte für einen dreimonatigen Grundwehrdienst, beschränkt auf Einsätze im Inland.
Neitzel und Wüstner befürworteten eine Auswahlwehrpflicht nach schwedischem Modell, bei der Freiwilligkeit Vorrang hat, aber im Bedarfsfall eine Einberufung möglich bleibt. Wüstner forderte zudem, bereits im Gesetz einen Mechanismus zur Aktivierung von Wehrpflichtigen zu verankern. Die Personalprobleme ließen sich jedoch nicht allein über Wehrpflichtige oder Freiwillige lösen, sondern erforderten strukturelle Reformen bei Zeit- und Berufssoldaten.
Kritik an Beteiligung junger Menschen
Für Kritik sorgte auch der Gesetzgebungsprozess selbst. Vertreter der Jugendorganisationen Bundesschülerkonferenz und Deutscher Bundesjugendring bemängelten, dass die Interessen junger Menschen bei der Ausarbeitung nicht berücksichtigt worden seien. Daniela Broda vom Bundesjugendring verwies auf positive Erfahrungen mit Jugendbeteiligung in anderen Ministerien. Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, forderte eine stärkere Einbindung junger Menschen und ein umfassendes Förderpaket in Bildung und Gesundheit. Zugleich betonte er, viele Jugendliche seien bereit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – auch außerhalb des Militärs.